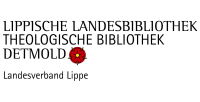Hausbau und Sozialstruktur einer niederdeutschen Kleinstadt : Blomberg zwischen 1450 und 1870 / Heinrich Stiewe. Detmold : Westfälisches Freilichtmuseum, 1996
Inhalt
- PDF Vorderdeckel
- PDF Vortitelblatt
- PDF Abbildung
- PDF Titelblatt
- PDF Impressum
- PDF 5 Editorial
- PDF 6 Vorwort
- PDF 7 Inhalt
- PDF 11 1. Einleitung
- PDF 11 1.1 Ziele der Arbeit
- PDF 15 1.2 Forschungsstand
- PDF 17 1.3 Quellen und Methoden
- PDF 21 1.4 Aufbau der Arbeit
- PDF 23 2. Die Stadt: Geschichte und Grundriß
- PDF 23 2.1 Stadtgeschichtlicher Überblick
- PDF 24 2.1.1 Naturräumliche und siedlungsgeschichtliche Voraussetzungen
- PDF 25 2.1.2 Von der Stadtgründung vor 1255 bis zur Zerstörung 1447
- PDF 29 2.1.3 Klostergründung und Reformation
- PDF 31 2.1.4 Städtische Verfassung und Verhältnis zur Landesherrschaft
- PDF 33 2.1.5 Wirtschaftliche Entwicklung
- PDF 36 2.1.6 Bevölkerungsentwicklung
- PDF 36 2.2 Topographie und Parzellenstruktur
- PDF 45 3. Die Häuser: Baustrukturen, Gestaltung und Bautechnik
- PDF 45 3.1 Steinbau
- PDF 45 3.1.1 Forschungsstand und Verbreitung
- PDF 45 3.1.2 Spätmittelalterlicher Steinbau
- PDF 47 3.1.3 Steinhäuser
- PDF 49 3.1.4 Keller
- PDF 51 3.1.5 Backsteinbau
- PDF 52 3.1.6 Zusammenfassung
- PDF 52 3.2 Fachwerkbau
- PDF 52 3.2.1 Der erhaltene Bestand
- PDF 54 3.2.2 Die Konstruktion des Hausgerüstes
- PDF 56 3.2.3 Geschoß- und Stockwerkbau
- PDF 57 3.2.4 Vorkragungen
- PDF 58 3.2.5 Wandgefüge
- PDF 59 3.2.6 Verstrebungen
- PDF 64 3.2.7 Ausfachungen des Fachwerks
- PDF 66 3.2.8 Dachwerke
- PDF 71 3.2.9 Dachdeckungen
- PDF 73 3.3 Äußere Gestaltung der Fachwerkbauten
- PDF 73 3.3.1 Forschungsstand
- PDF 74 3.3.2 Brettergiebel und Fachwerkgiebel
- PDF 75 3.3.3 Backsteinausfachungen und Ziersetzungen
- PDF 76 3.3.4 Fachwerkdekoration im 16. Jahrhundert
- PDF 78 3.3.5 Das Rathaus von 1587 und seine Wirkung auf die Fassadengestaltung von Fachwerkbauten in Blomberg
- PDF 82 3.3.6 Spätrenaissancefassaden des 17. Jahrhunderts
- PDF 87 3.3.7 Fassadengestaltung im 18. und 19. Jahrhundert
- PDF 90 3.3.8 Dielentore und Haustüren
- PDF 92 3.3.9 Fenster und Ausluchten
- PDF 99 3.3.10 Giebelpfähle und Wetterfahnen
- PDF 101 3.3.11 Die Verputzung von Fassaden im 19. Jahrhundert
- PDF 104 3.4 Der Bau eines Hauses
- PDF 104 3.4.1 Forschungsstand und Quellenlage
- PDF 106 3.4.2 Baurecht und Baustreitigkeiten
- PDF 108 3.4.3 Bauhandwerker
- PDF 109 3.4.4 Planung und Verding
- PDF 112 3.4.5 Materialbeschaffung und Bauvorbereitung
- PDF 114 3.4.6 Vorarbeiten auf der Baustelle
- PDF 115 3.4.7 Zimmerarbeiten
- PDF 117 3.4.8 Maurer- und Dachdeckerarbeiten, Malerarbeiten
- PDF 119 3.4.9 Baukosten im späten 18. Jahrhundert
- PDF 124 4. Die Räume: Raumstrukturen, Ausstatung und Nutzung
- PDF 124 4.1. Dielenhäuser und Flurhäuser
- PDF 124 4.1.1 Quellen
- PDF 125 4.1.2 Begriffe und Forschungsstand: Dielenhaus, Hallenhaus, "Ackerbürgerhaus"
- PDF 127 4.1.3 Zweischiffige Dielenhäuser
- PDF 127 4.1.4 Dreischiffige Dielenhäuser
- PDF 129 4.1.5 Hinterhäuser und Saalbauten
- PDF 130 4.1.6 Kleinhäuser
- PDF 134 4.1.7 Flur- und Etagenhäuser
- PDF 138 4.1.8 Hausformen und Raumstrukturen im 19. Jahrhundert
- PDF 140 4.2 Die Ausstattung der Räume und ihre Nutzung
- PDF 140 4.2.1 Offene Feuerstellen
- PDF 143 4.2.2 Offene Herdräume: Küchenluchten oder Winkel
- PDF 145 4.2.3 Geschlossene Küchen
- PDF 146 4.2.4 Stuben und Öfen
- PDF 149 4.2.5 Schornsteine
- PDF 151 4.2.6 Wohnstuben und Schlafkammern
- PDF 151 Stuben- und Kammertüten
- PDF 155 Paneele und Wandschränke
- PDF 156 Schlafkammern und Alkoven
- PDF 157 Wände und Decken
- PDF 159 4.2.7 Zur Verbreitung der Stuben im 19. Jahrhundert
- PDF 160 4.2.8 Zur Nutzung der Stuben und Kammern
- PDF 164 4.2.9 Säle und Hinterkammern
- PDF 168 4.2.10 Aborte
- PDF 170 4.2.11 Dielen
- PDF 173 4.2.12 Hausflure und Treppen
- PDF 174 4.2.13 Läden
- PDF 176 4.2.14 Ställe
- PDF 178 4.2.15 Keller
- PDF 178 4.2.16 Zwischengeschosse
- PDF 179 4.2.17 Speicherstockwerke und Dachböden
- PDF 181 4.3 Nebengebäude und Anbauten
- PDF 182 4.3.1 Scheunen
- PDF 183 4.3.2 Stallgebäude und -anbauten
- PDF 185 4.3.3 Mistplätze oder Düngergruben
- PDF 185 4.3.4 Gewerbliche Nebengebäude
- PDF 188 4.4 Zur materiellen Ausstattung Blomberger Haushalte im 18. Jahrhundert
- PDF 188 4.4.1 Quellenlage
- PDF 189 4.4.2 Ein Fallbeispiel: Der Haushalt des Kaufmanns Abraham Kersting nach einem Inventar von 1758
- PDF 192 4.4.3 Möbel und Wohnausstattung
- PDF 194 4.4.4 Herd- und Küchengerät, Hauswirtschaft
- PDF 196 4.4.5 Tisch- und Eßgerät
- PDF 198 4.4.6 Handwerkliches Arbeitsgerät und Materialien
- PDF 199 4.4.7 Land- und Viehbesitz, landwirtschaftliches Gerät und Vorräte
- PDF 201 4.4.8 Zusammenfassung
- PDF 202 5. Die Bewohner: Berufliche und soziale Gruppen und ihre Häuser
- PDF 203 5.1 Quellen und Methoden
- PDF 204 5.2 Handel: Kaufleute, Krämer, Höker
- PDF 206 5.3 Beamte und Honoratioren
- PDF 207 5.4 Ein Fallbeispiel: Die Blomberger Familie Theopold
- PDF 211 5.5 Landwirtschaft in der Stadt
- PDF 211 5.5.1 Landbesitz und Ackerbau
- PDF 214 5.5.2 "Ackerbürger": Ackersmänner oder Acker- und Fuhrleute
- PDF 216 5.5.3 "Ackerbürgerhäuser"
- PDF 217 5.5.4 Exkurs: Die Blomberger "Ackerbau- und Fuhrmannsbrüderschaft"
- PDF 221 5.6 Nahrungsgewerbe
- PDF 223 5.7 Lederverarbeitung: Schuhmacher und Gerber
- PDF 226 5.8 Textilproduktion: Zeugmacher und Leineweber, Schneider
- PDF 228 5.9 Holzverarbeitung: Tischler, Schreiner, Stuhlmacher
- PDF 229 5.10 Baugewerbe: Zimmerleute, Maurer, Glaser
- PDF 231 5.11 Sonstige Berufe und Bedienstete
- PDF 234 5.12 Tagelöhner, Witwen, Einlieger und Arme
- PDF 236 5.13 Juden
- PDF 239 6. Zusammenfassung: Aspekte von Hausbau und Sozialstruktur in einer Kleinstadt
- PDF 239 6.1 Dielenhaus, Hallenhaus und Flurhaus - zur Entwicklung des kleinstädtischen Hausbaus
- PDF 247 6.2 Zwischen Hellweg und Weser - zur kulturellen Orientierung Blombergs
- PDF 249 6.3 Abschied vom "Ackerbürger" - berufliche und soziale Differenzierung in der Kleinstadt
- PDF 253 Katalog der untersuchten Bauten
- PDF 325 Anmerkungen
- PDF 346 Anhang1: Tabellen
- PDF 350 Anhang 2: Ausgewählte Quellen zum Blomberger Bauwesen im 18. Jahrhundert
- PDF 356 Literaturverzeichnis
- PDF 366 Abbildungsnachweis
- PDF 367 Quellenverzeichnis
- PDF 367 Aufmaßverzeichnis
- PDF 368 Veröffentlichungen aus dem Westfälischen Freilichtmuseum Detmold
- PDF Rückdeckel